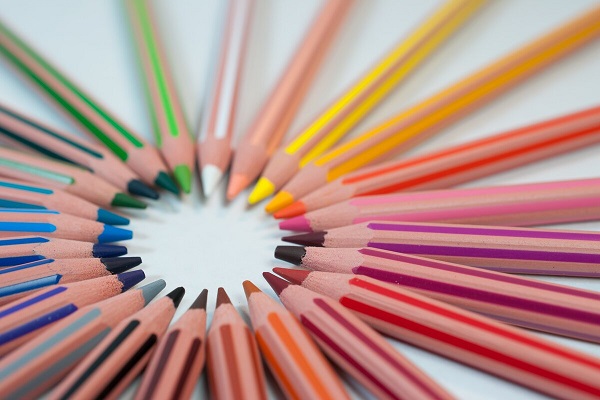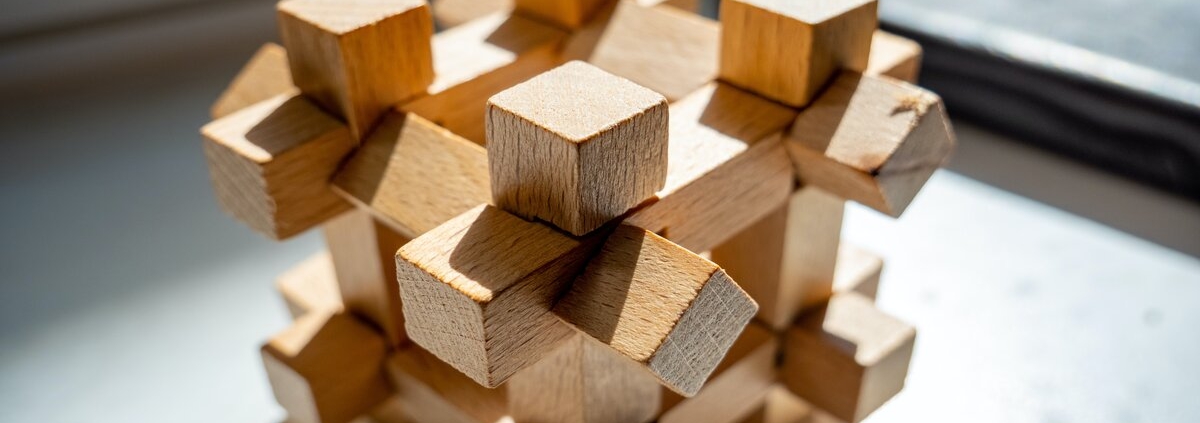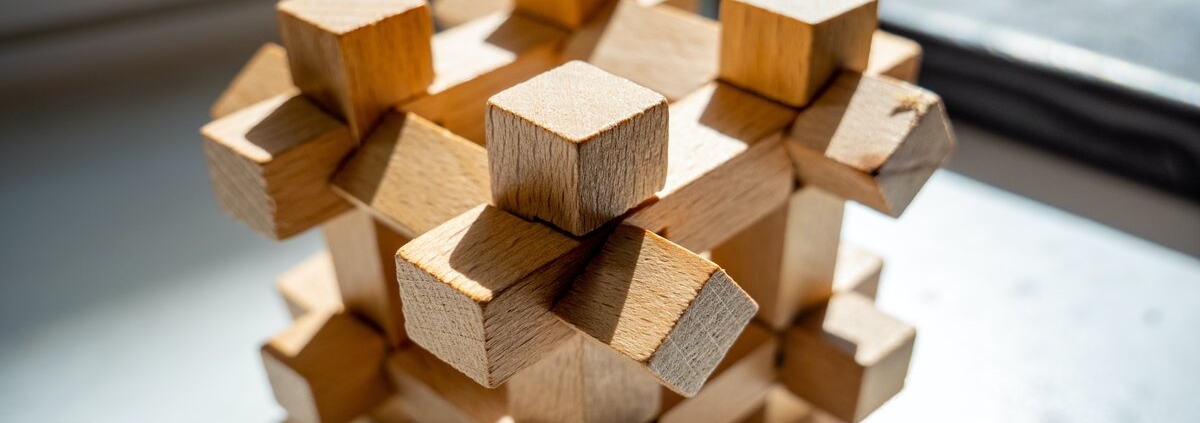In heilkundlichen und psychosozialen Arbeitsfeldern begegnen Fachkräften häufig Menschen, die unter innerer Unruhe, emotionaler Überforderung, Scham, Beziehungsunsicherheit oder Rückzug leiden. Belastende Lebens- und Beziehungserfahrungen spielen dabei oft eine zentrale Rolle ohne dass eine therapeutische Behandlung oder Traumabearbeitung angezeigt ist.
Dieses Angebot des Traumahilfezentrums München (THZM) vermittelt eine traumasensible, stabilisierende Grundhaltung, die Sicherheit schafft und Orientierung gibt im Gespräch, im Kontakt und im Alltag.
Ein einführender Vortrag führt in grundlegende Fragen ein:
– Was ist Trauma und welche Bedeutung hat dieses Wissen für psychosoziale und heilkundliche Begleitung?
– Welche Rolle spielen Bindungserfahrungen für heutige Reaktions- und Beziehungsmuster?
– Wie zeigen sich dissoziative Symptome und DIS im Alltag oft leise, situativ und schwer einzuordnen?
Darauf aufbauend werden haltungsgeleitete, alltagstaugliche Zugänge vorgestellt.
Dazu gehören eine stabilisierende und strukturierende Gesprächsführung, das frühzeitige Erkennen von Überforderung und eine regulierende Begleitung, die Förderung von Gegenwartsbezug und Selbstwahrnehmung sowie eine klare Rollenklärung und sichere Grenzsetzung.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Wie des Begleitens nicht auf Diagnostik oder einem therapeutischen Behandlungsauftrag.
Das Angebot richtet sich an
Heilpraktiker:innen, Sozialpädagog:innen und weitere psychosoziale Fachkräfte, die Menschen traumasensibel stabilisieren und ihre Arbeit sicher, klar und entlastend gestalten möchten.