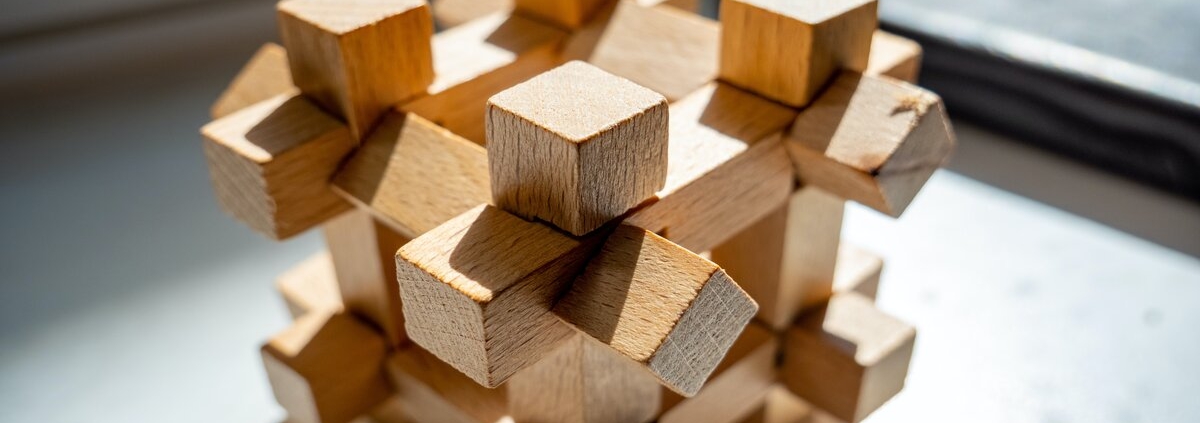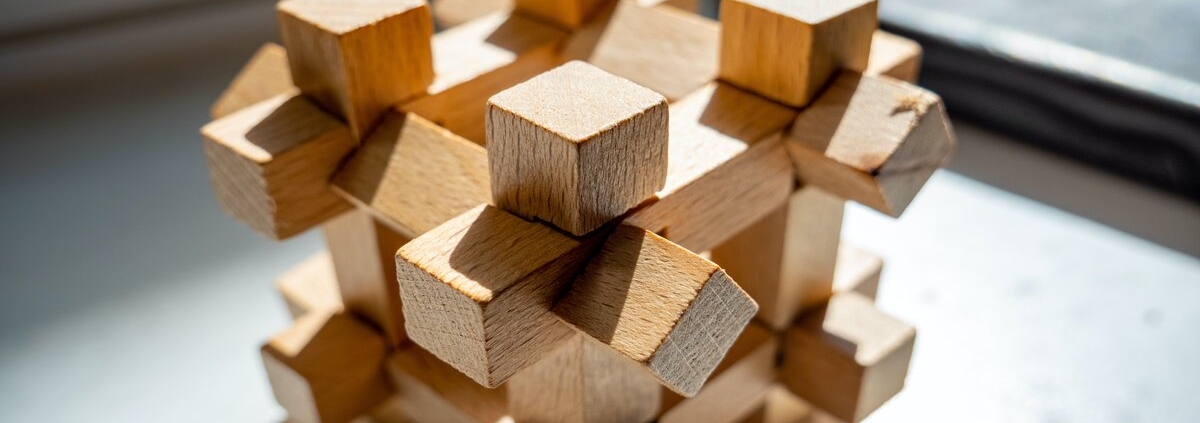Grundlagen zur Entstehung posttraumatischer Störungen, von Bindungstraumatisierungen zu Monotrauma bis zu schweren dissoziativen Störungen
Diagnostik nach multiaxialem Trauma-Dissoziations-Modell nach ICD-11:
o Kapitel „Spezifisch belastungsbezogene Störungen“ (6B4): posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), komplexe PTBS (kPTBS), Anhaltende Trauerstörung, Anpassungsstörung
o Kapitel „Dissoziative Störungen“ (6B6): Dissoziative Identitätsstörung (DIS), partielle DIS, dissoziativ-neurologische Symptomstörungen, Depersonalisa-tions-Derealisationsstörung, Dissoziative Amnesie. Zusätzlich: Imitierte und falsch positive DIS
o Persönlichkeitsstörungen, inkl. Borderline-Muster
o Komorbide Störungen
Differentialdiagnosen, insbesondere:
o Affektregulationsprobleme: kPTBS, Borderline-Muster, bipolare Störung, ADHS, pDIS/DIS
o Stimmenhören: DIS, Schizophrenie, u. a.
Fragebögen: Trauma und Dissoziative Symptome Interview (TADS-I, nach S. Boon & H. Mathess), International Trauma Questionnaire (ITQ), und andere
Verstehen von Traumadiagnostik als Prozessdiagnostik
Grundlagen für Berichte an Versicherungen, Krankenkassen, Strafverfolgungs- und Migrationsbehörden, und andere; Besonderheiten bei der Begutachtung
Inhalte aus dem DeGPT Curriculum: Vertiefungsmodul „Dissoziative Störung“ (2 Stunden)
– Strukturierte diagnostische Abklärung von Art und Schwere der Dissoziativen
– Symptome [c PTSD, (partielle) Dissoziative Identitätsstörung, partielle DIS und DIS (ICD 11)] und Störungen
– Differenzialdiagnostik mit anderen psychiatrischen Störungen (Psychosen, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen und Zwangserkrankungen). Klinisch therapeutische Implikationen
Zielgruppe: Fachleute und Interessierte.
Das Diagnostikseminar ist sowohl auf Einsteiger*innen wie auch auf Fortgeschrittene Fachleute ausgerichtet. Dies gelingt, indem z.B. mit ausführlichen Übersichtstabellen gearbeitet wird, die später im Selbststudium zur Vertiefung verwendet werden können.
!! Dieses Seminar kann unabhängig von den weiteren Seminaren besucht werden. Der Fokus liegt auf Wissensvermittlung und Besprechen von eigenen Fällen zur Verbindung von Theorie und Praxis.
Fortbildungspunkte werden bei der Bundesärztekammer beantragt.